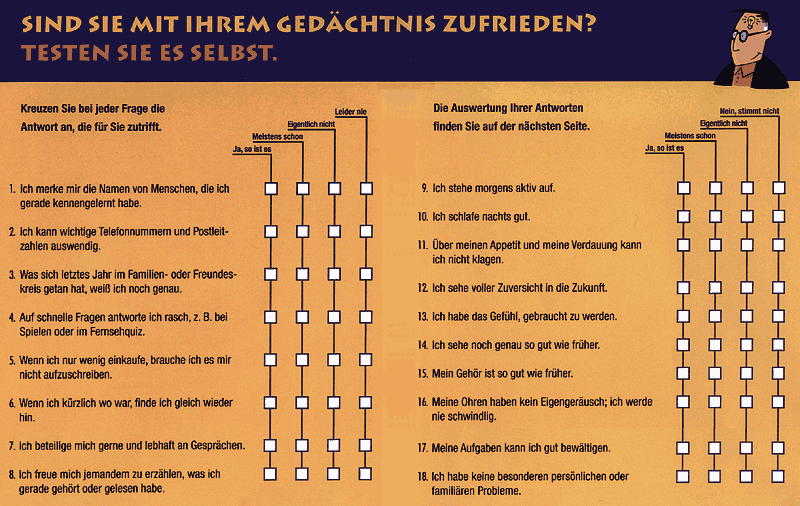aus: ÖAZ Aktuell, Ausgabe 2/2002
Keine Kassenfreiheit mehr
Der Kampf um Ginkgo
| |
 |
|
|
| |
Sind die
präsentierten Studien über Ginkgo ausreichend oder
nicht? |
| |
|
Kontroverse. Seit 1. Jänner 2002 sind
Arzneimittel mit dem Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761 (Tebonin®
retard, Tebofortan® und Ceremin®) nicht mehr auf Rechnung
der Sozialversicherungs träger frei verschreibbar. Das ist
das Ergebnis einer mit Vehemenz seitens der Ärzte, einiger
Patientengruppen und der Zulassungsinhaber Austroplant und Madaus
sowie auf der anderen Seite des Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger ausgetragenen Auseinandersetzung.
Der Arbeitskreis Gefäßtherapie des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger hat im Jahr
1997 empfohlen, die kassenfreie Verschreibbarkeit der Ginkgo-Präparate
zeitlich auf drei Jahre zu begrenzen, wenn nicht neue Studien vorgelegt
werden, die die freie Verschreibbarkeit rechtfertigen. Vom Zulassungsinhaber
der Präparate Tebonin und Tebofortan wurden Studien vorgelegt,
die den Wirknachweis für den Ginkgo-Extrakt EGb761 nach den
US-amerikanischen und europäischen Studienrichtlinien erbringen,
so die Hersteller. Nach Ansicht des Hauptverbandes waren diese Studien
nicht ausreichend. Deshalb wollte der Hauptverband die Ginkgo-Präparate
per Juli 2001 aus dem Heilmittelverzeichnis streichen. Vor allem
im Indikationsgebiet Alzheimer seien die Studienergebnisse nicht
aussagekräftig genug.
Damit wären die Präparate Ceremin®, Tebofortan®
und Tebonin® retard nicht nur nicht mehr für die Behandlung
des demenziellen Syndroms zur Verfügung gestanden, sondern
auch für folgende zugelassene Indikationen:
- zerebraler Mangeldurchblutung und Mangelernährung bzw.
Hirnleistungsstörungen mit den Symptomen der nachlassenden
intellektuellen Leistungsfähigkeit und Vigilanz wie Schwindel,
Ohrensausen, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Gedächtnisschwäche,
Ängstlichkeit und depressive Verstimmung;
- periphere arterielle Durchblutungsstörungen mit erhaltener
Durchblutungsreserve (Claudicatio intermittens)
- als unterstützende Behandlung eines infolge Zervikalsyndroms
beeinträchtigten Hörvermögens
Deshalb wurde unter der Patronanz der Österreichischen Gesellschaft
für Geriatrie und Gerontologie von internationalen Experten,
Hausärzten und den Zulassungsinhabern die Initiative ProCerebro
ins Leben gerufen. Erste Aktivität war ein Expertenmeeting am
27. November 2000, das die Auswirkungen einer allfälligen Streichung
der Ginkgo-Präparate aus dem Heilmittelverzeichnis auf die Finanzen
der Krankenkassen und die Patienten feststellen sollte.
Fazit des Expertenmeetings, das von 27 Experten unterschrieben wurde:
"Durch die Streichung der Ginkgo-Präparate aus dem Heilmittelverzeichnis
ist eine durch klinische Studien gut belegte und in der Praxis bewährte
Arzneimittelgruppe nicht mehr ohne soziale Barriere zugänglich.
Es gibt keine pharmakologisch und ökonomisch gleichwertigen Alternativen.
Die Streichung bewirkt die Einschränkung der therapeutischen
Möglichkeiten bei älteren Menschen und damit eine weitere
Diskriminierung der Senioren, obwohl Ginkgo-Präparate alle international
anerkannten sechs Kriterien der Erstattungsfähigkeit Sicherheit,
Wirksamkeit, Qualität, klinisch-ökonomische Effektivität,
Bezahlbarkeit und Angemessenheit erfüllen.
Für die Krankenkassen entstehen durch die Streichung der Ginkgo-Präparate
aus dem Heilmittelverzeichnis Mehrkosten bis zu 36,3 Mio. Euro/500
Mio. ATS.
Es ist mit einer Kostensteigerung im Bereich der Pflegeversicherung
zu rechnen."
Das Expertenpapier wurde den Fachbeiräten des Hauptverbandes
vorgelegt, die die Meinung der Experten jedoch als nicht stichhältig
abtaten. In einem Beharrungsbeschluss bestand der Hauptverband weiter
auf der Streichung. Daraufhin wurde die Öffentlichkeit in einer
Pressekonferenz am 8. Mai 2001 über die Situation informiert.
Teilnehmer waren unter anderem der Präsident des Hausärzteverbandes
Dr. Christian Euler und Prim. Dr. Marion Kalousek von der Österreichischen
Alzheimer Liga. Auf der Pressekonferenz wurde auch ein offener Brief
vorgestellt, der in ärztlichen Ordinationen und Apotheken aufgelegt
sowie in allen Regionalmedien und in der Kronen Zeitung veröffentlicht
wurde. Innerhalb weniger Wochen erbrachte die Brief-Aktion 120.000
Unterschriften. Der Brief war an Minister Haupt und den damaligen
Präsidenten des Hauptverbandes, Hans Sallmutter, mit der Bitte
gerichtet, die Empfehlung nochmals zu überdenken. Die vier Waschkörbe
voll Unterschriften wurden Anfang Juni vor der Presse den Adressaten
übergeben. Minister Haupt deutete an, die Entscheidung des Hauptverbandes
zur Streichung der Präparate zumindest bis Jänner 2002 aussetzen
zu lassen.
Parallel zur Unterschriftenaktion erhielten alle Abgeordneten zum
Nationalrat, für den Bereich Gesundheit zuständige Landespolitiker
und weitere wichtige Personen des Gesundheitswesens einen Brief, der
auf die Maßnahme des Hauptverbandes und deren Auswirkung aufmerksam
machte.
Gespräch mit dem Hauptverband
Am 6. Juni 2001 wurde ein weiterer Termin mit dem Hauptverband koordiniert.
Das als Gespräch im kleinen Kreis geplante Meeting wurde schließlich
zu einer großen Runde, an der unter anderem auch Vertreter
der Österreichischen Apothekerkammer – Vizepräsidentin
Dr. Christiane Körner und Vizepräsident Mag. pharm. Friedrich
Hoyer – teilnahmen. Doch auch diese Mammutrunde konnte den
Hauptverband nicht umstimmen. Eine Intervention beim neuen Präsidenten
des Hauptverbandes, Dr. Herwig Frad, änderte auch nichts am
Entschluss des Hauptverbandes, Ginkgo-Präparate aus der Kassenzulässigkeit
zu nehmen.
Die vereinten Bemühungen von Experten, Ärzten, Apothekern
und Patienten brachte jedoch eine Verzögerung der Streichung
von 3 Monaten.
Der Hersteller
"Ginkgo-Präparate sind hochwirksame pflanzliche Arzneimittel.
Es gibt kein anderes Phytotherapeutikum mit mehr als 500 wissenschaftlichen
Arbeiten", so Dr. Pierre Saffarnia, Pressesprecher der Austroplant
Arzneimittel GmbH. in Wien, die derartige Präparate vertreibt.
Diese Arzneimittel würden die Gedächtnisleistung signifikant
erhöhen und könnten bei der Alzheimer-Krankheit eine Verbesserung
der sozialen Fertigkeiten bewirken sowie einen Heimaufenthalt hinauszögern.
Für bisherige Bezieher sprechen daher wichtige Argumente dafür,
die Ginkgo-Präparate weiterhin einzunehmen.
"27 namhafte Mediziner aus dem In- und Ausland stehen mit ihrer
Unterschrift auf einem Expertenpapier für diese Arzneimittel
ein."
Austroplant als Zulassungsinhaber von Tebonin und Tebofortan werde
nun verstärkt die Betroffenen und die Bevölkerung über
Wirksamkeit und Nutzen der Ginkgo-Wirkstoffe informieren.
Hauptverband: Kein relevanter Patientennutzen
In einer Aussendung des Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger hingegen heißt es:
"Der Fachbeirat hat empfohlen, die seit Jahren umstrittenen
Ginkgo-Präparate aus dem Verzeichnis zu streichen: Die in erster
Linie gegen Hirnleistungsstörungen eingesetzten Medikamente
können zwar weiterhin ärztlich verschrieben werden, die
Krankenkassen kommen mit Jahresbeginn 2002 grundsätzlich aber
nicht mehr für die Kosten auf.
Vorausgegangen ist in Österreich eine jahrelange Diskussion
um Ginkgo-Präparate, die in manchen westlichen Ländern
nicht einmal als Arzneimittel zugelassen sind: 1997 hatte der Fachbeirat
die Verschreibbarkeit der Produkte, die hauptsächlich gegen
Hirnleistungsstörungen eingesetzt werden, auf drei Jahre befristet
und die weitere Verschreibbarkeit vom Ergebnis neuer Studien abhängig
gemacht.
Expertisen, die den tatsächlichen relevanten Nutzen für
Patienten belegen, konnten allerdings trotz wiederholter Ankündigung
von Pharmaunternehmen nicht vorgelegt werden. Gleichzeitig belegen
andere Ginkgo-Studien keine positiven Ergebnisse bei altersbedingten
Gedächtnisstörungen. "Es existieren auch keine wissenschaftlichen
Daten, die eine Wirksamkeit von Ginkgo bei Tinnitus belegen würden",
stellt der beratende Arzt des Hauptverbandes, Univ.-Prof. Dr. Klaus
Klaushofer, fest. Zudem sind in der Zwischenzeit neue Präparate
zur Behandlung der Alzheimer-Demenz auf dem Markt, die zwar teurer,
aber in ihrer Wirkung besser belegt sind.
Die Anführung von Ginkgo-Präparaten im Heilmittelverzeichnis
ist daher nach Expertenmeinung nicht länger vertretbar. Um
den Betroffenen Zeit zu geben, wird dieser im Sommer gefasste Beschluss
erst mit 1.1.2002 umgesetzt: Ärzten und Patienten blieb genug
Zeit, gemeinsam andere therapeutische Maßnahmen zu planen.
Ob sich die Krankenkassen, die im Vorjahr 16,4 Mio. Euro/226 Mio.
ATS für Ginkgo-Präparate ausgegeben haben, durch diese
Maßnahme Geld ersparen, ist offen.
Mit der Streichung werden nicht in Hinblick auf den dringend notwendigen
Sparkurs den Patienten Medikamente vorenthalten. Im Sinne der Qualitätssicherung
soll aber nur Geld für Präparate ausgegeben werden, deren
Nutzen medizinisch einwandfrei belegt ist." (»Sozialversicherung
aktuell«, Nr. 229 vom 7. Jänner 2002)
Ginkgo-Präparate:
Selbst kaufen oder darauf verzichten?
Nach dem Wegfall der Kassenfreiheit stellt sich für die bisherigen
Bezieher der EGb 761-Präparate nun die Frage: "Soll ich
sie mir jetzt selbst kaufen oder darauf verzichten?"
Entscheidungsgrundlagen dafür werden wohl
• der Preis,
• die Wirksamkeit und
• die Notwendigkeit
einer Behandlung sein.
Preis
Mindestmengen von 80 bis 160 mg Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761 gelten
heute als therapeutisch notwendig. Das bedeutet selbst bei 160 mg
Ginkgo-Extrakt AVP-Tageskosten, die unter einem »Kleinen Braunen«
liegen (s. Tabelle)!
| Ginkgo-Präparat |
Packungsgröße
und Preis |
Tageskosten für 80 mg |
| Tebofortan
Tabl. 40 mg/Tr. 4% |
50
St./50 ml = 16,35 Euro |
0,65 Euro (9,0 ATS) |
| Cerebokan
Tabl. 80 mg |
30
St./16,75 Euro
60 St./29,70 Euro |
0,56
Euro (7,70 ATS)
0,50 Euro (6,80 ATS) |
| Ceremin
Tabl. |
50
St./15,70 Euro |
0,63 Euro (8,60 ATS) |
Wirksamkeit
Es gibt kein anderes Phytopharmakon mit so vielen wissenschaftlichen
Arbeiten. Die EGb 761-Dokumentation wurde in den letzten Jahren
laufend verbessert und entspricht den heutigen Anforderungen, wie
Prof. Marksteiner bei den Südtiroler Herbstgesprächen
erläuterte (siehe Bericht in dieser Ausgabe auf S. 62).
Notwendigkeit
Die Grenze zwischen bloßer Vergesslichkeit und dem Beginn
eines demenziellen Abbauprozesses ist fließend, kann aber
mittels standardisiertem Testverfahren erfasst werden. Der Abbau
betrifft anfänglich das Kurzzeit-Gedächtnis, später
auch das Langzeit-Gedächtnis. Um den Kunden die Selbsteinschätzung
zu erleichtern, wird in der Kundenzeitung »Die Apotheke«
Nr. 1/2002 der abgebildete Test abgedruckt, der auf Erfahrungen
der Gedächtnisambulanz am AKH-Wien (Univ.-Prof. Dr. Peter Dal
Bianco) fußt.
Die Antworten erlauben eine grobe Einschätzung
• von Gedächtnis und Denkvermögen (Fragen 1–6)
• von Sozialkompetenz ( Fragen 7–8)
• von körperlicher und psychischer Stabilität (Fragen
9–13)
• eventuell vorliegender Multiinfarktfolgen (Fragen 14–16)
• von depressiven Anzeichen (Fragen 17–18)
Am Beginn einer Alzheimer-Demenz steht:
• die Abnahme der Gedächtnisleistung (Fragen 1–6)
• bei sonst erhalten gebliebenen anderen Funktionen (Fragen
7–13 und 17–18)
• Defizite bei Fragen 14–16 sollten zu einem raschen Arztbesuch
führen.
Auffälligkeiten bei Fragen 1–6 deuten auf »Mild
Cognitive Impairment« (MCI), einer Vorstufe von Alzheimer,
hin, bei der sich Gedächtnis und Denkvermögen durch EGb
761 nachweislich verbessern lassen. Eine ärztliche Betreuung
sollte bei der Indikation Alzheimer stets gegeben sein.
|